PD Dr. Alexander Ilic, Co-Founder und Executive Director ETH AI Center im Dialog mit Fabian Forrer, IFBC Sector lead Technology

Am ETH AI Center verfolgt PD Dr. Alexander Ilic als Executive Director das Ziel, interdisziplinäre Forschung mit realwirtschaftlichen Anwendungen zusammenzuführen und die Schweiz als global führenden Standort für vertrauenswürdige, verantwortungsvolle KI zu positionieren. Ein besonderes Anliegen von PD Dr. Alexander Ilic ist die Frage, wie AI-Technologien nicht nur technische, sondern auch wirtschaftliche Wirkung entfalten können. Im Spätsommer 2025 ist das öffentlich entwickelte Large Language Model APERTUS erschienen, das unter der Leitung des ETH AI Centers und der EPFL zusammen mit dem Schweizer Supercomputing Centre (CSCS) entstand.
Im Rahmen des Zurich AI Festivals respektive des AI+X Summit – das jährliche Highlight des ETH AI Centers – diskutiert die AI-Community die Rolle der Schweiz im globalen AI-Umfeld sowie die Chancen und Risiken, die Künstliche Intelligenz für Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringt. IFBC hat bei PD Dr. Alexander Ilic nachgefragt, wie die Schweizer Wirtschaft ihre KI-Transformation erfolgreich gestalten kann und was in seinen Augen «the next big thing» im Bereich KI ist.
Alexander Ilic gibt im Dialog mit Fabian Forrer, IFBC Sector lead Technology, Einblicke in seine Arbeit an der ETH Zürich und erläutert wie der Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft einzuordnen ist.
Wenn KI ein Marathon ist, dann befinden wir uns aktuell bei Km 5. Wie bei allen technischen Disruptionen ist es ein Trugschluss, dass allein der Zugang etwas verändert. Beim Internet machte die Tatsache, dass ich einen Anschluss habe keinen grossen Unterschied. Produktivitätsgewinne erfolgten aus den Ansätzen Digital First und Mobile First. Gleiches gilt bei der AI. Der Einsatz von ChatGPT suggeriert, man wäre schon angekommen. Viele Unternehmen lernen so in kleinen, ersten Schritten, was die neue Technologie kann und wie man sie einsetzt. Ein grosses Potenzial für Wertschaffung besteht ja in der Interaktion zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Um die Innovationskraft von KI freizusetzen, müssen jedoch die Kernprozesse und Geschäftsmodelle mittels "AI First" erneuert werden.
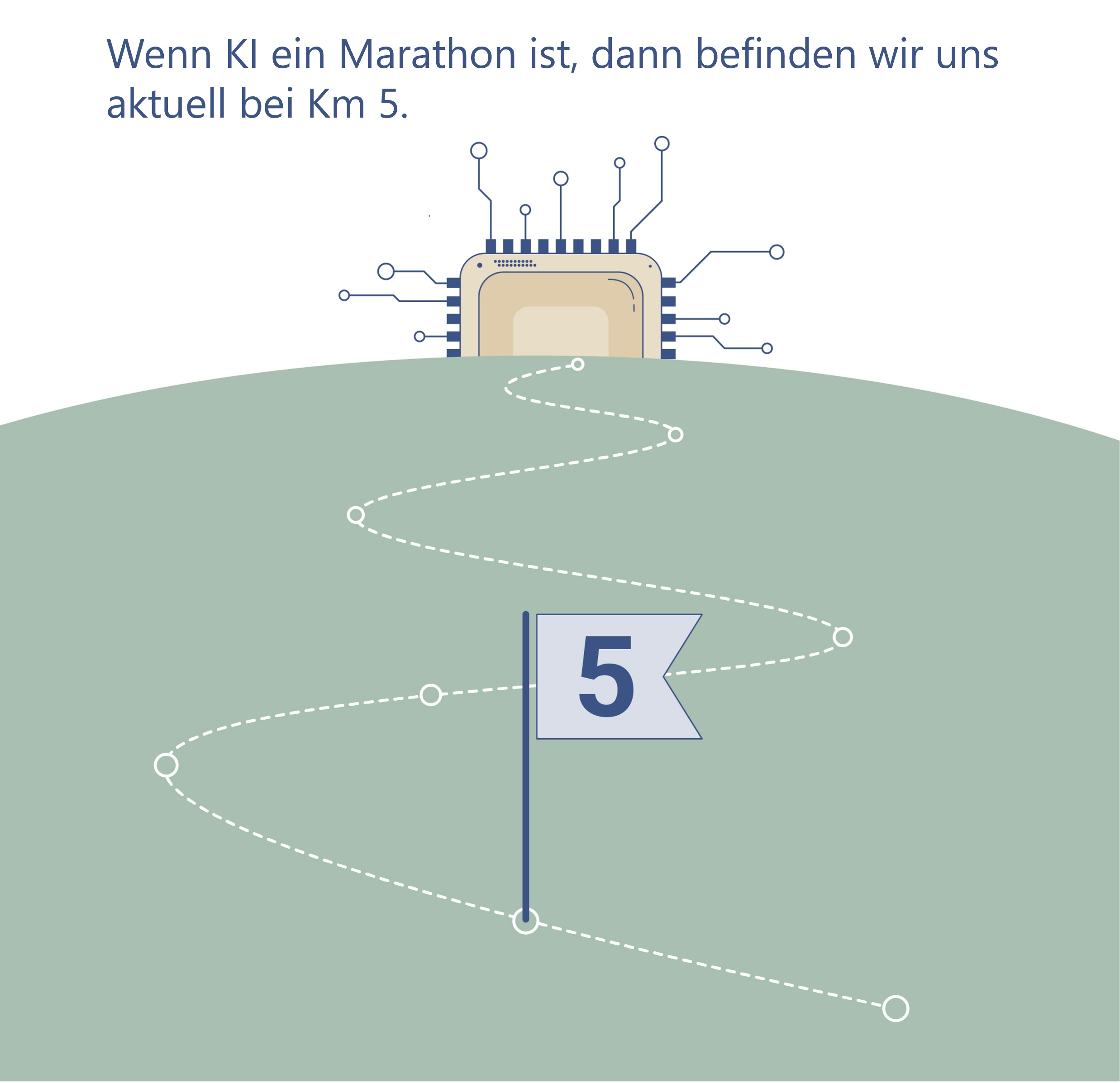
Die Zurückhaltung der Unternehmen ist stark auf die Unsicherheit zurückzuführen, was bei der Nutzung eines AI-Grundmodelles (Foundational Model) mit den Daten geschieht. Die grossen ausländischen Anbieter sind aktuell noch zu wenig vertrauenswürdig und hinzu kommt die geopolitische Situation mit den USA und China. Weiter ist zentral, dass im Training der KI keine Verzerrungen (Bias) beispielsweise sozialer, kultureller und technischer Natur entstehen. Deshalb ist APERTUS für die Schweiz ein Durchbruch und wird den technologischen Wandel in der Schweiz beschleunigen.
APERTUS ist ein unabhängiges, vertrauenswürdiges Foundational Model ohne Bias und schafft damit viel Vertrauen. Es senkt gar insgesamt für die Schweizer KMU die Einstiegshürde zu AI. Wichtig zu verstehen ist, dass alle Foundational Models – insbesondere auch die ausländischen – sich in einer Preisspirale nach unten befinden und die Margen sich ausdünnen, da die Kosten ein solches zu erstellen laufend abnehmen und die Konkurrenz steigt. In naher Zukunft werden diese zur Commodity ohne Wettbewerbsvorteile. APERTUS wurde als Allgemeingut konzipiert. Die Wertschöpfung geschieht dann auf den höheren Layern (Schichten) bei den Anwendungen, Geschäftsmodellen und Sektoren. Hier hat die Schweiz eine riesige Chance, weil damit in gewissen Bereichen auch Teile der Wertschöpfungskette zurück in unser Land verlagert werden können. Hier wird es zu Verschiebungen kommen.
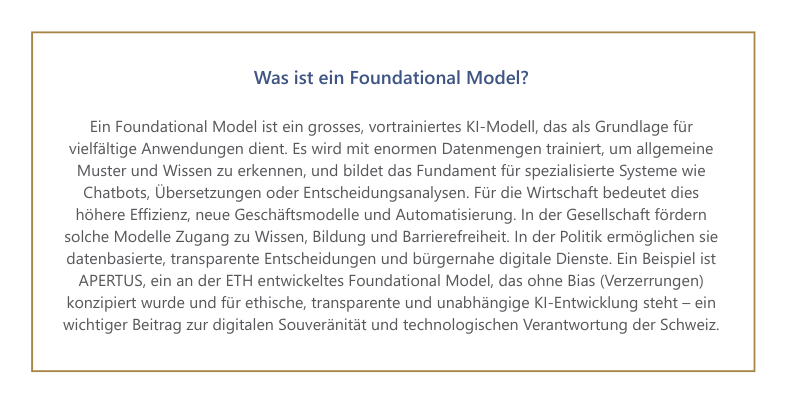
Die Frage nach «Make or Buy» ist nicht trivial. Nach meiner Einschätzung müssen Unternehmen nicht zwingend First Mover sein. Man hat dies beim Wechsel von der analogen auf die digitale Fotografie beobachtet: Die anderen Anbieter egalisieren den Vorsprung schnell. Am Anfang machen viele auch noch den einen oder anderen Fehler und nur wenige haben die Sicherheit, dass der Business Case in der Summe aufgeht. Beim Coding (Programmieren) ist man mit KI drei bis zehn Mal so effizient, aber man muss zuerst erkennen, was sich durch den Einsatz von KI verändert und wieviel dies kostet respektive langfristig einspart. Dem Effizienzgewinn stehen auch Aufwände für Anschaffungen und Nacharbeiten wie die Qualitätskontrolle und Behebung von Fehlern gegenüber. Man muss am Ende hinter dem Produkt stehen können. Die Nutzung von KI wird zu Beginn nicht nur das IT-Budget belasten, sondern die Transformation wird insgesamt personelle und finanzielle Mittel binden, die wieder eingespielt werden müssen. Wer heute ein AI-First-Unternehmen entwickeln will, muss mit hohen Investitionen rechnen. Erfolgsversprechender sind aktuell First-Follower-Ansätze.
Dies kann durch aus Sinn machen – auch um die Bedeutung von KI für das eigene Geschäft zu verstehen und erste Erfahrungen zu sammeln. Zudem können Ansätze wie externe Inkubatoren zum Erfolg im Umgang mit neuen Technologien beitragen. Jedenfalls ist dieser Ansatz besser, als sich in zu grosse Abhängigkeiten von Dritten zu begeben. Insbesondere wenn man mit eigenen Daten grosse AI-Lerneffekte erzielt, denn dadurch entsteht ja der eigentliche und grosse Wertzuwachs. Man sollte sich von Zeit zu Zeit die Frage stellen: Wieviel profitieren Dritte und komme ich da wieder raus? Wenn KI durchschlägt, dann verändern sich in der Folge die Kernprozesse und das Geschäftsmodell eines Unternehmens.
Es gibt ja die Wette von Sam Altman zum One-Person-Unicorn (Unicorn = Bewertung von ≥ 1 Milliarde USD). Dabei ist die Frage nicht ob es so weit kommt, sondern wann. Viele Dinge kann man heute mit weniger Leuten erreichen. Für die Entwicklung einer neuen Geschäftsidee oder eines Prototyps reichen heute ein Team mit wenigen, aber den richtigen Leuten und Light Coding (einfache Programmierarbeiten). Um weiterzukommen und zu skalieren, bedarf es dann aber mehr Know-How und mehr menschliche Ressourcen. Die Verbindung von menschlicher und künstlicher Intelligenz zu Human KI bringt viele Vorteile. Einerseits sind die Menschen wichtig, um Best Practices beizusteuern, Daten zu validieren, Fehler zu korrigieren und finale Entscheidungen zu treffen. Beim Entwickeln des Autonomen Fahrens könnte es beispielsweise spannend sein, aus den Daten der mit fünf Sternen ausgezeichneten Lenkern zu lernen, wie man die KI besser machen kann, anstatt nur auf Simulationen zu setzen. Andererseits lernen die Mitarbeitenden von der KI und es entsteht ein sich verstärkendes System.
Wichtig ist es für die Schweizer Wirtschaft eine kritische Masse aufzubauen. Wir verfügen über ca. 800 Experten, die bereits sogenannte Frontier AI-Modelle bauen können und bilden an der ETH jährlich ca. 50-100 weitere aus. Talent ist in diesem Gebiet super knapp und wir müssen dem Nachwuchs auch die besten Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen. Der Supercomputer Alps hat gezeigt wie wichtig genügend GPUs sind, um kompetitiv zu sein. Wir benötigen nicht die grösste Rechnerleistung weltweit, aber ein sehr hohes Niveau, um mitzuhalten. Deshalb hat man in der Schweiz auch die Kräfte der ETH, EPFL und dem CSCS gebündelt. In Zürich und Umgebung befinden sich auch darum viele internationale Anbieter, weil wir mit der ETH viel Wissen und Talente zur Verfügung stellen. Teilweise werben sich Tech-Giganten untereinander ganze Teams ab und bieten dabei Summen, welche eher an Transfers im Fussball erinnern. Wenn es im AI-Markt zu einer «Blase» kommt, dann weil es zu wenig Talente im Markt hat. Um Kompetenzen aufzubauen, kann auch M&A eingesetzt werden.

Der Wert einer AI-Anwendung wird durch viele Faktoren wie Genauigkeit, Kosten-/Nutzen-Verhältnis, Lernfähigkeit, etc. beeinflusst. Wir achten hierbei stark auf die Feedback-Loops, also wie stark jeder einzelne Nutzer durch seine Interaktionen das System beeinflusst und wie stark die Verbesserung beim nächsten Mal sichtbar ist. Insgesamt muss die AI-Anwendung Daten generieren, um besser zu werden und einen Vorsprung aufzubauen, der verteidigbar ist. Dabei spielen auch grössere Foundation Models als Wegbereiter eine Rolle. Die ETH beschäftigt sich derzeit mit solchen in den Bereichen: Heath, Education und Finance. Diese Sektoren haben grosses Potenzial.
Als Verwaltungsrat oder Geschäftsleitung sollte man verstehen, ob ein "AI First"-Wettbewerber am Entstehen ist. Das heisst ein Unternehmen, welches nicht vereinzelt über seine Organisation kleine AI-Initiativen streut, sondern mittels "AI First" seine Kernprozesse neugestaltet. Weiter gilt es die regulatorischen Rahmenbedingungen verantwortungsvoll auszugestalten, aber ohne die Schweiz gegenüber dem Ausland zu benachteiligen. Wir haben in den Bereichen Drohnen sowie Krypto gute Beispiele für dialogorientierte Innovationsgefässe in der Schweiz. Der nächste Produktivitätsschub ist zu erwarten, wenn KI weg vom Rechner hin zu den Robotern und Mobile Devices springt. Es wird spannend zu sehen sein was geschieht, wenn KI nicht nur auf eine Eingabe im Rechner reagiert, sondern permanent beobachten kann, was passiert und sich auf dieser Basis verbessert. Dies wird nach meiner Einschätzung «The next big thing». Die Schweizer sind erst in dieses neue Zeitalter gestartet und wir bereiten mit unseren Zurich AI Festivals respektive dem AI+X Summit den Weg in die Zukunft.
.png)
PD Dr. Alexander Ilic (rechts) ist Geschäftsführer des ETH AI Center in Zürich und eine führende Persönlichkeit an der Schnittstelle von Forschung, Unternehmertum und gesellschaftlicher Verantwortung im Bereich Künstliche Intelligenz. Nach seiner Promotion an der ETH Zürich und Stationen als Unternehmer, u.a. Mitgründer und CEO von Dacuda (an Magic Leap verkauft), verbindet er heute akademische Exzellenz mit praxisnaher Umsetzung.
Fabian Forrer (unten) unterstützt als bei IFBC als Partner und Sector lead Technology mit seiner Erfahrung und Expertise insbesondere Technologie-Unternehmen, mittelständische und kapitalmarktfähige Unternehmen unterschiedlicher Sektoren sowie Private Equity Investoren in den Bereichen Corporate Finance, public und non-public M&A sowie Finanzierungen.